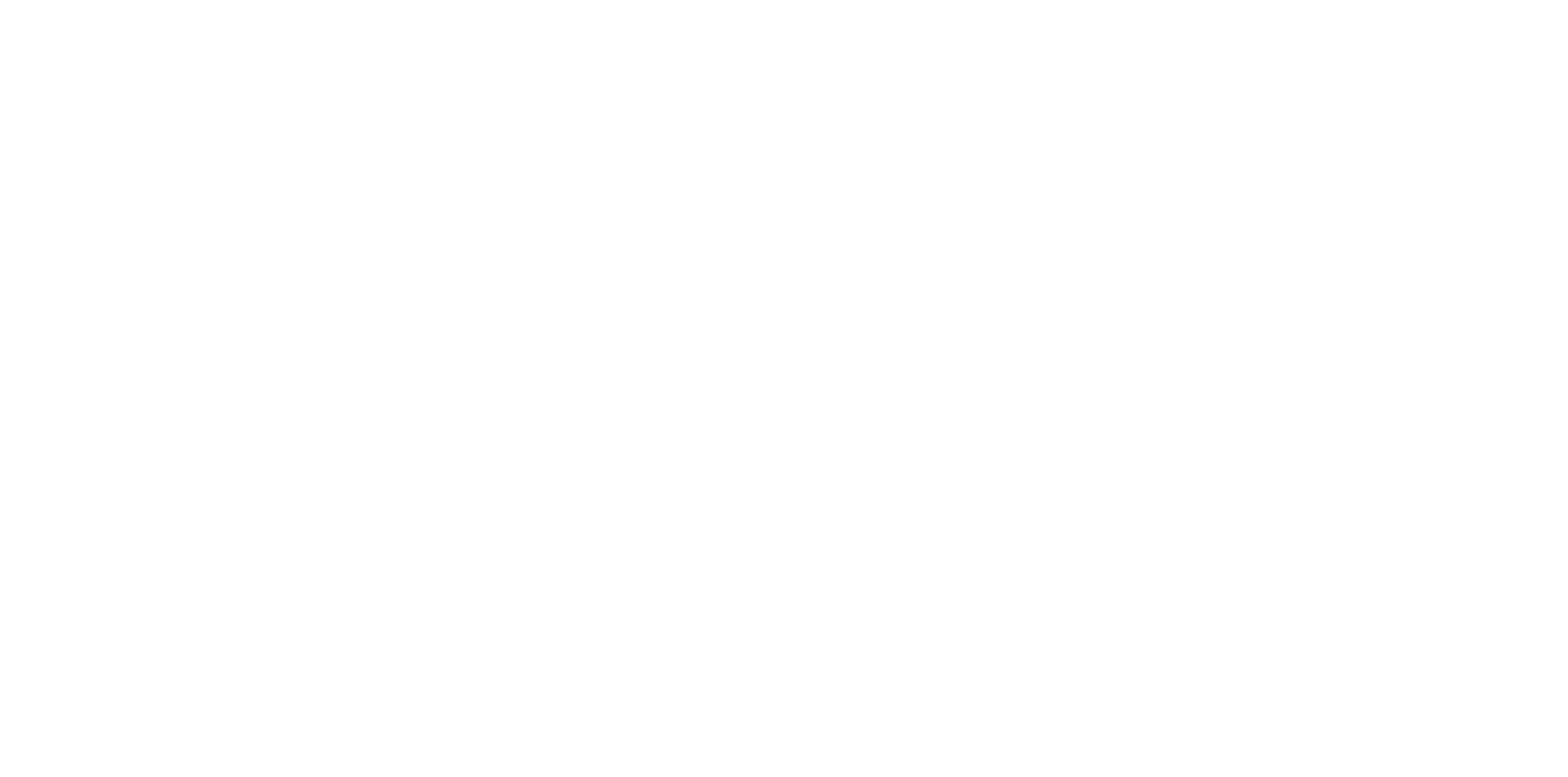Willkommen in der Römischen Badruine in Badenweiler

Sie ist ein einzigartiges Zeugnis für die Badekultur und das Savoir Vivre, welches die Römer schon im ersten Jahrhundert nach Christus in die Region am Oberrhein gebracht haben: Die Römische Badruine in Badenweiler. Und das Wort einzigartig ist wortwörtlich zu verstehen, denn die historische Badeanlage zählt zu den besterhaltenen Thermenruinen nördlich der Alpen, und in Deutschland ist sie einmalig. Neben der weithin sichtbaren Burgruine Baden stellt sie ein zweites Wahrzeichen für den beliebten Traditionskurort dar, und sie zieht jährlich Tausende von Besuchern an. Die Heilquellen von Badenweiler werden unter der Regierung des Kaisers Vespasian (69 bis 79 n. Chr.) entdeckt. Es ist die Zeit, als sich römische Bürger und Soldaten im alemannischen und keltischen Raum häuslich niederlassen und neben ihren Gesetzen auch ihre Lebensart mitbringen.
Aquae Villae – Wasserstadt Badenweiler

Die sehr auf ihre Gesundheit und Lebenslust bedachten Römer beginnen umgehend damit, eine Therme zu bauen, und nicht nur das. Sie errichten eine regelrechte kleine Stadt mit Wohnhäusern, Läden und Kultstätten, die sie „Aquae Villae“ nennen, was „Wasserstadt“ bedeutet. Die Therme selbst wird großzügig als doppelsymmetrische Anlage ausgebaut und erhält jeglichen Komfort und Luxus, den sich die römischen Bürgerinnen und Bürger nur wünschen können: Zunächst entstehen die vier Thermalbecken, später kommen dann Empfangs-, Umkleide- und Personalräume dazu, außerdem Schwitzräume mit einem Kaltwasserbecken sowie eine steinumfriedete Terrasse. Und natürlich gibt es auch Ruheräume und sogar Räume zum Heizen in der kalten Jahreszeit. Das Thermalwasser wird aus den oberhalb gelegenen Quellen mit Leitungen aus Holz- und Bleirohren in das Bad geleitet. Die wärmste dieser Quellen hat die angenehme Temperatur von 26,4 Grad.
Gebadet wird im Übrigen streng getrennt nach Geschlechtern. Die berühmten römischen Orgien sind hier eher nicht an der Tagesordnung, es gelten vielmehr die moralisch hohen Ideale der römischen Zivilisation. Dafür genießt man allen erdenklichen Luxus des Badelebens: Heiße und kalte Bäder, Duschen, Schwitzkuren, Massagen, Gymnastik und Ruhephasen.

Selbstverständlich ist die Therme einer römischen Gottheit geweiht, wie es damals üblich ist: Der jungfräulichen Diana. Da die Römer aber prinzipiell die Religionen der eroberten Völker anerkennen, weihen sie die Anlage in Reverenz an eine heimische Göttin der „Diana Adnobia“. So verschmilzt in „Aquae Villae“ der Kult der römischen Jagdgöttin mit dem der geheimnisvollen Muttergöttin des Schwarzwalds. Ein am Grabungsort gefundener Weihestein dokumentiert diesen Sachverhalt. Und natürlich existiert auch ein Tempel, in welchem die Göttin verehrt werden kann.
Leider endet das römische Luxusleben mit dem Niedergang der Römer im 3. Jahrhundert. Kelten und Germanen nutzen zwar die schöne Anlage weiter, aber mit der Zeit wird sie dem Verfall preisgegeben. Dass die Kelten und Germanen das Bad zerstören, ist eher unwahrscheinlich, da sie ebenfalls das Baden schätzen. Im Mittelalter hinterlässt dann das schwere Erdbeben von 1356, bei dem die Stadt Basel zerstört wird, wahrscheinlich auch seine Spuren an der alten Therme. So oder so – das Bad fällt in einen Jahrhunderte langen Dornröschenschlaf.
Im 18. Jahrhundert wiederentdeckt
Man schreibt das Jahr 1784, als Bauarbeiter, die im Auftrag des Markgrafen Karl Friedrich von Baden in Badenweiler Arbeiten verrichten, auf die Überreste der Therme stoßen. Den Einwohnern von Badenweiler sind Bedeutung und Zweck der Anlage, die man nur „das Gmür“ nennt, schon lange nicht mehr bekannt. Sie ist über Jahrhunderte hinweg mehr oder weniger als Steinbruch genutzt worden. Man nennt sie irrtümlich „Klösterle“ und „Einsiedelei“. Der aufgeklärte und historisch interessierte Fürst lässt das Bauwerk freilegen und unter seinen Schutz stellen sowie eine Reihe von Maßnahmen zum Erhalt durchführen. Er wird in seinem Vorhaben unterstützt durch den amtierenden evangelischen Pfarrer Jeremias Gmelin, der selbst ein Amateur-Altertumsforscher ist, und den die sensationelle Entdeckung umtreibt. Hauptsächlich diesen beiden Persönlichkeiten ist es zu verdanken, dass die Wiederentdeckung der Badruine zu einer „Sternstunde für Badenweiler“ wird, wie es in Gustav Fabers bekanntem Buch „Badenweiler – Ein Stück Italien auf deutschem Grund“ so schön heißt. Unter den Überresten, auf die man bei den Bauarbeiten stößt, befindet sich das Herzstück der Therme: Die Mauern eines rund 65 mal 34 Meter messenden Bades, das zwei Meter über dem Fundament gelegen ist.

Mit seinem Entschluss, die römische Therme freizulegen und zu erhalten, liegt der Markgraf übrigens im Trend der Zeit. Im 18. Jahrhundert wird auch das durch einen Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 nach Christus unter Aschebergen begrabene Pompeji wieder ausgegraben.
Im 19. Jahrhundert entsteht oberhalb der Badruine ein neues Thermalbad. In Gedenken an die römische Vorgeschichte wird es als klassizistischer Marmorbau im pompejanischen Stil erbaut. Mit diesem Neubau erlangt Badenweiler erneut den Ruf eines großen Heilbades, welches den Adel und das Großbürgertum anlockt.
Zwar ist die Römische Badruine seither immer ein beliebtes Ausflugsziel für Neugierige und Historiker, doch im Jahr 2001 erhält sie neuen Glanz. Mit großem Aufwand und nicht unerheblichen Kosten entsteht ein kolossales Schutzdach aus Glas und Stahl, um das kostbare Denkmal aus römischer Zeit vor weiteren Verwitterungen zu schützen. Diese Konstruktion stellt eine architektonische Meisterleistung aus 1725 quadratischen Glasscheiben dar. 3150 Quadratmeter bemisst die Glasfläche für das aufgrund der Hanglage tonnengewölbte Dach und die Fassade. Ein großartiges und effizientes Tragwerk, das durch seine Leichtigkeit und Transparenz die Badruine zu einer kulturellen und architektonischen Besonderheit macht.
Freilichtmuseum, Veranstaltungsort und Hochzeitslocation

Da die Römische Badruine zu den landeseigenen Monumenten zählt, wird sie von der Einrichtung „Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg“ betreut.
Natürlich konnte es nicht ausbleiben, dass dieses kostbare Stück Altertum mit seiner großartigen Atmosphäre nicht nur als Freilichtmuseum sowie für Besichtigungen und Führungen genutzt wird. Es ist auch für die Reihe „DAS BESONDERE KONZERT“ ein außergewöhnlicher Veranstaltungsort. In diesem Jahr gibt es dort zwei Vollmondkonzerte: am 12. Juli mit Sandy Williams und Henry Uebel, und am 9. August mit Tilo Wachter (Hang, Gong & Stimme).
Zudem ist die Römische Badruine ein außergewöhnlicher Ort für standesamtliche Trauungen. Getreu dem Ausspruch „Si me amas“ (Wenn Du mich liebst) geben sich unter dem filigranen Himmel aus Glas seit dem Jahr 2011 immer wieder zahlreiche Liebespaare das Ja-Wort. Brautpaare, die diese besondere Location für die standesamtliche Trauung auswählen, terminieren diesen Tag im Standesamt Badenweiler. Die Brautleute kommen inzwischen aus ganz Deutschland. Ein Ja-Wort in dieser besonderen Atmosphäre ist schon so eine kleine Sensation. Hier wird es noch spektakulärer und einzigartig in der Erinnerung.

Römische Badruine Badenweiler
Kaiserstraße 5
79410 Badenweiler
07632 / 799100
info@sb-badenweiler.de
www.badruine-badenweiler.de
Dieser Beitrag sowie sämtliche Bilder wurden uns von unserem Medienpartner Bollenwood ® Verlag | Werbung | Events zur Verfügung gestellt. Die aktuelle Ausgabe des Magazins "Wohin im Markgräflerland" können Sie hier als PDF online einsehen.

Alle Texte und Bilder unterliegen dem Urheberschutzgesetz. Sämtliche Inhalte dieser Seite wurden uns vom WOHIN Magazin zur Verfügung gestellt.